Afrikanische Arzneipflanzen und Jagdgifte
Chemie, Pharmakologie, Toxikologie
Hans Dieter NeuwingerWissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 1998, 2. völlig neu berarbeitete und erweiterte Auflage, 100 farbige Abb., zahlreiche Illustrationen, € 91.-
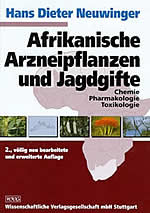 Dieses
1000 Seiten starke, auf 25 Jahren eigener Feldforschung beruhende
Werk eines einzelnen Forschers beeindruckt in vieler Hinsicht. 300
afrikanische Pflanzen, die alle bis heute als Jagdgifte, zur Wilderei
und in Stammesfehden eingesetzt werden, daneben aber auch bei den
verschiedenen Jagdvölkern als Medizinalpflanzen eine vielfältige
Verwendung finden, sind nach botanischen Namen alphabetisch geordnet
und ausführlich beschrieben. Beobachtungen und Befragungen
bei Medizinmännern, Jägern und Giftbereitern und die Erkundung
der Pflanzennamen auch in den afrikanischen Stammesdialekten bilden
die Grundlage des Buches. Die Bearbeitung der internationalen und
bis 200 Jahre zurückreichenden Literatur zu Ethnologie, Pharmakologie,
Toxikologie und Botanik machen das Buch mit seinen über 1000
Strukturformeln und 30 Seiten Pflanzenverzeichnis zu einem ausgezeichneten
Standardwerk der afrikanischen Ethnomedizin und Ethnopharmakologie.
Die Beschreibungen der Bereitung von Gift für die Jagd mit
Pfeilen, des Perlhuhnfangs, der tödlichen Vergiftungen von
Soldaten in den Kolonialkriegen und des Einsatzes von Fischfanggiften
sind auch für Laien sehr gut lesbar und interessant. Die ethnomedizinischen
Anwendungen durch die lokalen Heiler und die erstaunliche Breite
der Indikationen, die teilweise durch die seit 100 Jahren bestehenden
toxikologischen Untersuchungen nachvollzogen werden können,
sind spannend zu lesen wie ein Kriminalroman. Aus der afrikanischen
Volksmedizin konnten so wichtige Arzneipflanzen wie die Strophantus-Arten
und Wirkstoffe wie das Reserpin in unser Medizinsystem eingeführt
werden. Bei vielen nur oberflächlich untersuchten Pflanzen
konnte mittlerweile Aktivität gegen Malaria und andere Tropenkrankheiten
bestätigt werden. Schmerzstillende, herzwirksame, anästhetisierende,
bakterizide, virusstatische oder zytotoxische Wirkstoffe wurden
ebenfalls nachgewiesen. Oft beruhen die toxischen Effekte, die bei
der Jagd auch auf Großtiere so erfolgreich eingesetzt wurden,
auf dem gleichen Wirkprinzip wie die therapeutischen Effekte. Der
Unterschied zwischen Therapie und tödlicher Wirkung ist oft
eine Frage der Dosierung. Dies zeigt deutlich, wie wichtig die Beachtung
des enormen, aber im Aussterben befindlichen Erfahrungsschatzes
indogener Völker auch für die moderne Medizin ist; denn
die zielgerichte Untersuchung dieser erprobten Gifte liefert weit
schneller brauchbare Ergebnisse als wahllose Screening-Tests.
Dieses
1000 Seiten starke, auf 25 Jahren eigener Feldforschung beruhende
Werk eines einzelnen Forschers beeindruckt in vieler Hinsicht. 300
afrikanische Pflanzen, die alle bis heute als Jagdgifte, zur Wilderei
und in Stammesfehden eingesetzt werden, daneben aber auch bei den
verschiedenen Jagdvölkern als Medizinalpflanzen eine vielfältige
Verwendung finden, sind nach botanischen Namen alphabetisch geordnet
und ausführlich beschrieben. Beobachtungen und Befragungen
bei Medizinmännern, Jägern und Giftbereitern und die Erkundung
der Pflanzennamen auch in den afrikanischen Stammesdialekten bilden
die Grundlage des Buches. Die Bearbeitung der internationalen und
bis 200 Jahre zurückreichenden Literatur zu Ethnologie, Pharmakologie,
Toxikologie und Botanik machen das Buch mit seinen über 1000
Strukturformeln und 30 Seiten Pflanzenverzeichnis zu einem ausgezeichneten
Standardwerk der afrikanischen Ethnomedizin und Ethnopharmakologie.
Die Beschreibungen der Bereitung von Gift für die Jagd mit
Pfeilen, des Perlhuhnfangs, der tödlichen Vergiftungen von
Soldaten in den Kolonialkriegen und des Einsatzes von Fischfanggiften
sind auch für Laien sehr gut lesbar und interessant. Die ethnomedizinischen
Anwendungen durch die lokalen Heiler und die erstaunliche Breite
der Indikationen, die teilweise durch die seit 100 Jahren bestehenden
toxikologischen Untersuchungen nachvollzogen werden können,
sind spannend zu lesen wie ein Kriminalroman. Aus der afrikanischen
Volksmedizin konnten so wichtige Arzneipflanzen wie die Strophantus-Arten
und Wirkstoffe wie das Reserpin in unser Medizinsystem eingeführt
werden. Bei vielen nur oberflächlich untersuchten Pflanzen
konnte mittlerweile Aktivität gegen Malaria und andere Tropenkrankheiten
bestätigt werden. Schmerzstillende, herzwirksame, anästhetisierende,
bakterizide, virusstatische oder zytotoxische Wirkstoffe wurden
ebenfalls nachgewiesen. Oft beruhen die toxischen Effekte, die bei
der Jagd auch auf Großtiere so erfolgreich eingesetzt wurden,
auf dem gleichen Wirkprinzip wie die therapeutischen Effekte. Der
Unterschied zwischen Therapie und tödlicher Wirkung ist oft
eine Frage der Dosierung. Dies zeigt deutlich, wie wichtig die Beachtung
des enormen, aber im Aussterben befindlichen Erfahrungsschatzes
indogener Völker auch für die moderne Medizin ist; denn
die zielgerichte Untersuchung dieser erprobten Gifte liefert weit
schneller brauchbare Ergebnisse als wahllose Screening-Tests.Pflanzenheilkunde in Deutschland, die ebenfalls eine lange Tradition besitzt und breite Anwendung und Akzeptanz in der Bevölkerung findet, gilt als sanfte Medizin. Kritiker sprechen gar von Wirkungslosigkeit angesichts der Verwendung verschiedener Tees für den Wohlgeschmack. Diese Zweifel sind bei den tropischen Jagdgiftpflanzen Afrikas völlig unangebracht. Alle im Buch beschriebenen Pflanzenpräparate werden zu einem Ziel eingesetzt: sie töten, lähmen oder verstärken in bestimmten Kombinationen ebensolche Wirkungen auf das Beutetier.
Dem Autor und seinem Buch ist eine breite Leserschaft unter Ethnologen, Pharmakologen, Chemikern, Medizinern und Interessierten Laien zu wünschen. Ohnehin wird das Buch für lange Zeit eine einmalige Referenz bleiben.
Einheimische Arzneipflanzen: Der herzwirksame Weißdorn
Stefanie Goldscheider













